|
|
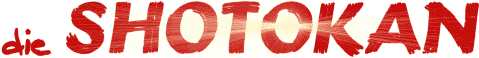 |
|
|
|
|
|
© 2002 A. Krause |
Letzte Aktualisierung: Sonntag, 01. Dezember 2002 |
Karate-Dô - wörtlich „Der Weg der leeren Hand” - ist in erster Linie eine Kampfkunst, bei der durch den Einsatz des ganzen Körpers maximale Kraft auf einen kleinen Punkt konzentriert wird (jap. Kime).
„Leere Hand“ bedeutet dabei zunächst, dass der Karateka nur seinen eigenen Körper benutzt und sich keiner anderen Waffen bedient. Die Techniken des Karate-Dô machen vielmehr von den verschiedensten Körperteilen gebrauch. Im Unterschied zu anderen japanischen Kampfkünsten setzt man im Karate-Dô auch die Beine und Knie zum Treten und Schlagen ein.
1. Trainingselemente
Die
Übung der Kata bildet das Herz des Karate-Dô. „Keiko“
der japanische Ausdruck für Training bedeutet wörtlich übersetzt
„an das alte denken“. Um die in den Kata enthaltenen Techniken und
Prinzipien der Körperbeherrschung zu erlernen, bedarf es einer extrem
hohen Anzahl von Wiederholungen. Zu diesem Zweck werden die grundliegenden
Techniken und Prinzipien des Karate-Dô im Kihon
einzeln perfektioniert, bis sie unbewusst und natürlich zur Verfügung
stehen. Die
praktische Anwendung dieser Techniken und Prinzipien unter Beachtung von
Reaktion, Timing, Distanz und Kontrolle mit einem Partner erfolgt im Kumite. Die drei Bestandteile des Karatetrainings sind untrennbar miteinander verbunden und bilden eine Einheit.
2.
Selbstverteidigung Als
Kampfkunst dient Karate seinem Ursprung nach in erster Linie der eigenen
Verteidigung, sowohl gegen unbewaffnete als auch bewaffnete Angreifer.
Dieses Grundprinzip wird besonders in der Ausführung der Kata deutlich,
welche immer mit einer defensiven Bewegung anfängt. Das Kumitetraining
schließlich beinhaltet untrennbar die Auseinandersetzung mit einer
unmittelbaren physischen Aggression. Die Effektivität
des Karate als Selbstverteidigung beruht auf der Tatsache, dass die
Berührung des Gegners immer mit der Ausführung einer Karatetechnik
3. Körperliche Fitness Die Bedeutung des Karate-Dô als Kampfkunst erschöpft sich jedoch nicht in dem Aspekt der Selbstverteidigung. Das Training der ursprünglich zu diesem Zweck entwickelten Techniken in Kihon, Kata und Kumite stellt eine der besten Methoden zur Erhaltung und zum Ausbau der körperlichen Fitness dar. Grundsätzlich gilt, dass durch die Übung einer Kampfkunst die Körpermotorik und -wahrnehmung ein einem besonderen Maße gefördert wird. Die
positiven körperlichen Auswirkungen des Karatetrainings sind
darüber hinaus äußerst vielfältig: · Flexibilität Die Beweglichkeit des menschlichen Körpers ist mit ungefähr 10 Jahren auf ihrem natürlichen Höhepunkt angelangt. Wird sie danach nicht gezielt entwickelt, so lässt sie immer mehr nach, was in alltäglichen Bewegungsabläufen zu Problemen, wenn nicht gar Schmerzen führen kann. Durch den Einsatz des ganzen Körpers wirkt das Karatetraining einer Versteifung entgegen. Zum richtigen Karatetraining gehören immer auch begleitende Lockerungs- und Dehnübungen. · Schnellkraft Die Fähigkeit Bewegungen mit maximaler Geschwindigkeit auszuführen ist geradezu typisch für Karate-Dô. Durch das Training kann die Schnellkraft auch über ihren natürlichen Höhepunkt im Alter von etwa 20 Jahren hinaus erhalten und verbessert werden. · Muskeltonus Etwa mit dem 30. Lebensjahr beginnt der natürliche Muskeltonus des menschlichen Körpers nachzulassen. Karatetechniken erfordern am Ende jeder Bewegung eine totale durch die Atmung koordinierte kurzzeitige Anspannung der Muskulatur (Kime). Durch die große Vielfalt verschiedener Karatetechniken und die grundsätzlich beidseitige Beanspruchung, werden nahezu alle Muskelgruppen des Körpers trainiert, so dass hier einer Verschlechterung entgegen gewirkt werden kann. · Kondition Bekanntlich
sind Menschen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren zu maximalen
Ausdauerleistungen fähig, danach ist die Kondition rückläufig. Die hohe
Anzahl von Wiederholungen beim Karatetraining belastet den Körper immer
auch im Ausdauerbereich, so dass hier Erkrankungen vorgebeugt werden kann. Die
Konzentration dieser Gesichtspunkte im Karate-Dô ist nahezu einzigartig.
Karatetraining ist somit auch ein Mittel, um altersbedingt nachlassenden Körperfunktionen
entgegenzuwirken. Die geschilderten positiven Auswirkungen können
allerdings nicht innerhalb weniger Wochen erfahren werden, sondern sind
vielmehr das Ergebnis regelmäßigen langjährigen Trainings.
3. Geistige Vervollkommnung Den physischen Elementen des Trainings im Karate-Dô steht der mentale Aspekt gegenüber. Die Übung japanischer Kampfkünste (Budô) ist richtig verstanden immer auch ein Mittel zur eigenen geistigen Vervollkommnung. Während die Kampfkünste in kriegerischen Zeiten fast ausschließlich zum schnellen und wirkungsvollen Töten des Feindes geübt wurden, so wandelte sich diese Anschauung in Friedenszeiten. Aus der kriegerischen Fertigkeit (jap. Jitsu) wurde der Weg zur eigenen Vervollkommnung (jap. Dô). Karate-Dô zielt mithin nicht nur auf die Bezwingung einer äußeren Bedrohung, sondern vielmehr auf die eigenen inneren Schwächen und Unebenheiten, das eigene kleine Ego. Im harten, entbehrungsreichen Training, wird man seiner eigenen Schwächen bewusst und soll sie schließlich hinter sich lassen. Der Karateka soll sein Inneres leer und rein werden lassen, wie ein klarer Spiegel, der unmittelbar und unverfälscht alles wiedergibt, was sich vor ihm zeigt. Das ist die tiefere Bedeutung von „Kara“=leer. So
verstanden und vermittelt, fördert Karate-Dô Innere Stärke,
Konzentration, Willenskraft und Durchhaltevermögen, aber auch Demut
und Bescheidenheit, sowie Respekt anderen gegenüber.
4. Sportliche Aspekte Neben den traditionellen Werten einer Kampfkunst gibt das moderne Karate dem athletisch veranlagten Karateka auch die Möglichkeit, seine Fähigkeiten im sportlichen Wettkampf mit anderen zu vergleichen. Karate-Wettkämpfe werden in den Disziplinen Kata und Kumite abgehalten. Die Ausführung der Kata wird von den Schiedsrichtern u.a. nach formalen (Ablauf, korrekte Richtung, Kiai), dynamischen (Körpereinsatz, Kime, Atmung, Spannung und Entspannung) und Stimmungsaspekten (Sicherheit, Kampfgeist, Zanshin) bewertet. Kumitewettkämpfe hingegen beruhen auf dem Ippon-Prinzip. Die Wettkämpfer sollen bestrebt sein, die eine, alles entscheidende Technik zu erlangen, die Aspekte wie Reaktion, Timing, Distanz und vor allem Kontrolle in sich vereint. Letzteres bedeutet nicht nur, dass man den Gegner nicht trifft, weil man es nicht kann, sondern vielmehr weil man es nicht will obwohl man es könnte. Kime und Kontrolle sind daher zwei Seiten einer Medaille. Ohne Kontrolle kein Kime – ohne Kime keine Kontrolle. Soweit
Schiedsrichter, Instruktoren und Wettkämpfer diese Werte nicht aus den
Augen verlieren sind Wettkämpfe eine spannende und attraktive
Bereicherung für das Karate-Dô. Allerdings machen sie nur einen kleinen
Teil des Karate-Dô aus. Wettkämpfe, die losgelöst vom harten, alltäglichen
Training von Kihon, Kata und Kumite mit seinen körperlichen und geistigen
Aspekten existieren, gibt es nicht. Im traditionellen Karate-Dô ist der
Erfolg im Wettkampf immer nur ein Nebenprodukt des harten Trainings.
Es liegt in dieser Vielfalt des Karate-Dô zwischen modernem Sport und traditioneller Kampfkunst mit ihren körperlichen und geistigen Aspekten begründet, dass der „Weg der leeren Hand“ fast jedem etwas zu bieten hat, unabhängig vom Alter, Geschlecht oder athletischer Veranlagung.
|